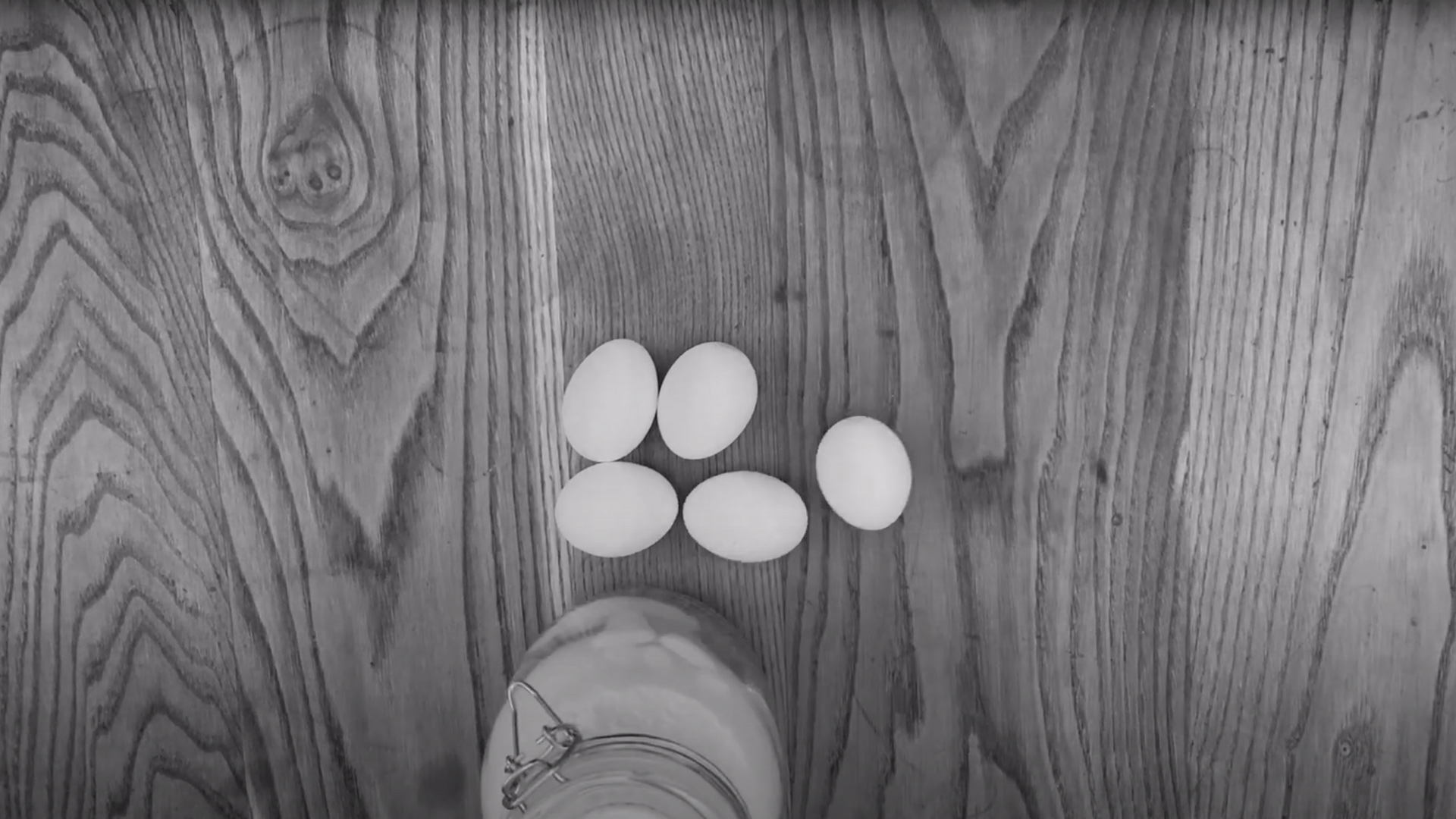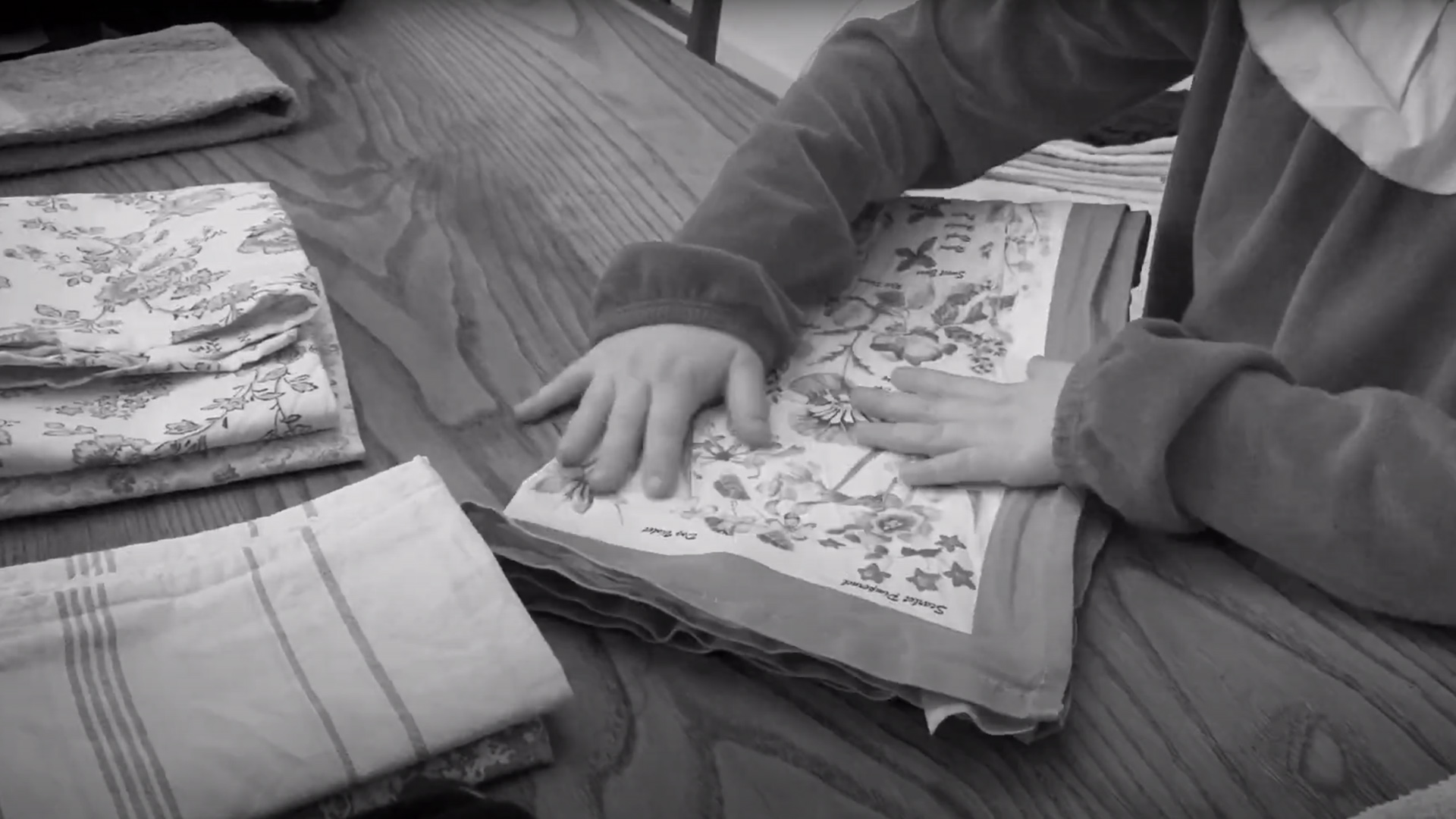Modul 4: Tasten, Gehen und Roboten
Warum schimpft Mama mit dem Computer?
Auch wenn zig Filme uns glauben machen wollen, wie schlau Computer doch sind, ist der Alltag meist ernüchternd. Der PC zuhause macht nicht, was er soll, und bekommt dafür Schimpfe von Mama. Papa wiederum erkennt wenig Verstand in den „intelligenten Programmen“ von Haushaltsgeräten. Einzig der Bruder zeigt sich zufrieden mit der Künstlichen Intelligenz seiner Computerspielgegner.
Im vierten Modul lernen die Schülerinnen und Schüler die hohe Kunst sich dumm zu stellen. Wer einem Computer jemals etwas beibringen möchte, muss all das vergessen können, was sie oder er intuitiv beherrscht: fühlen, riechen, sehen, sprechen.
Die Unterrichtseinheiten
Piraten versenken
Land- und Seekarten sind frühe Beispiele für eine Digitalisierung des Raumes.
Modul 4: Tasten, Gehen & Roboten
Schatzsuche
Für Menschen sind Pfade verschlungen, für Roboter eckig.
Modul 4: Tasten, Gehen & Roboten
Modul 3: Zwiebeln, Rezepte und Algorithmen
Warum schmeckt´s bei Mama am besten?
Spielen und Kochen haben etwas gemeinsam: Wenige Elemente lassen sich mit wenigen Regeln zu unendlich vielen Gerichten und Formen kombinieren. Allein aus Mehl und Eiern lassen sich Bucatini, Fettuccine, Linguine oder Tagliatelle, Maccheroni und Canneloni zaubern. Und wer das Soffritto, die gebratene Mischung aus feingewürfelten Zwiebeln und Wurzelgemüsen beherrscht, die oder der kann sich Höherem wie Ragouts, Schmorbraten oder Bruschettas widmen. Doch solche Grundrezepte müssen erlernt werden. Denn sie sind sind die Algorithmen, auf denen alles weitere beruht.
Im dritten Modul sind Schüler*innen und Schüler Künstler*innen, die aus wenigen Dinge Überraschendes schaffen. Sie zerschneiden Bilder und arrangieren die Elemente neu oder sie zaubern aus wenigen Kochzutaten noch nie dagewesene Gerichte.
Übergeordnete Ziele
- Die Kinder erkennen Algorithmen im Alltag.
- Die Schüler*innen entdecken Freiräume für kreative Herangehensweisen.
- Die Schüler*innen dekodieren Kulturtechniken und arrangieren die Elemente neu.
- Den Kindern erschliessen sich soziale und natürliche Gesetzmässigkeiten.
Die Unterrichtseinheiten
roh & gekocht
Kochen ist Programmieren. Aus wenigen Zutaten und begrenzten Zubereitungsarten entstehen unzählige neue Gerichte.
Modul 3: Zwiebeln, Rezepte & Algorithmen
All in
Wie eine Minisprache weisen Gesellschaftsspiele ein Alphabet (Figuren, Karten etc.) sowie eine Grammatik (Summe der Regeln) auf. Beides lässt sich verändern.
Modul 3: Zwiebeln, Rezepte & Algorithmen
Kunst aufräumen
Im frühen 20. Jahrhundert begannen Künstler*innen, digital zu malen.
Modul 3: Zwiebeln, Rezepte & Algorithmen
Alea iacta est.
Zufalls- oder aleatorische Kunst kennt man vor allem aus der Musik. Kinder übertragen sie auf die bildende Kunst.
Modul 3: Zwiebeln, Rezepte & Algorithmen
Modul 2: Regale, Stapel und Zeiten
Warum darf ich nicht drängeln?
Wir sind umgeben von Strukturen, die Dinge ordnen. Wir wären verloren, würden im Supermarkt Milch, Eier, Chips und Müsli auf einem Haufen statt in Regalen lagern. An der Kasse käme es zu Handgreiflichkeiten, hätten wir nicht gelernt, in einer Schlange anzustehen. Ohne Uhr, Stundenpläne und Terminkalender würden wir uns immer nur zufällig begegnen.
Im zweiten Modul werden Schülerinnen und Schüler zu Forscher*innen, die verschiedene Ordnungen analysieren und neue erschaffen. Sie untersuchen Supermärkte, sie räumen zuhause das Geschirr um und lernen, wie Ordnung und Zeit zusammenhängen.
Übergeordnete Ziele
- Die Kinder entdecken die Prinzipien, nach denen Dinge im Alltag geordnet sind.
- Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass Ordnungen nicht selbstverständlich, sondern menschengemacht sind.
- Die Kinder erkennen, nach welchen Kriterien Ordnungen funktionieren: Effizienz, Übersichtlichkeit, Gewinnmaximierung, Nachhaltigkeit etc..
- Die Schülerinnen und Schüler erkennen und nutzen Gestaltungsspielräume.
Die Unterrichtseinheiten
Kleingeist
Täglich sortieren wir Wäsche, Münzen oder E-Mails. Doch Sortieren ist nicht einfach Sortieren.
Modul 2: Regale, Stapel & Zeiten
bäumig
Bäume gibt es nicht nur in der Natur, sondern auch im Kopf. Dort helfen sie uns, Entscheidungen zu treffen oder Daten schlau zu speichern.
Modul 2: Regale, Stapel & Zeiten
Modul 1: Zeichen, Codes und Etikette
Warum darf ich nicht in der Nase bohren?
In China ist Rülpsen zu Tisch ein Zeichen für eine gute kommunistische Gesinnung und leckeres Essen. In der Schweiz ein Zeichen für fehlende Kinderstube und mangelnden Anstand. Kämen Ausserirdische als Gäste zu uns, wüssten sie nicht, wie sich zu benehmen. All diese geheimen Zeichen und verborgenen Codes!
Im ersten Modul werden Schülerinnen und Schüler zu Marsmenschen, die unsere Kultur auf ihre Zeichen hin analysieren. Wie Spione aus einer anderen Welt lernen sie die Bedeutung von Gesten, Tischmanieren, Emoticons, Nullen und Einsen zu dekodieren. Ganz nebenbei lernen sie, neue Zeichen zu erfinden und zu kombinieren.
Übergeordnete Ziele
- Die Schüler*innen erkennen, wie stark unser Zusammenleben durch Normen, Regeln und Codes festgelegt ist.
- Die Kinder suchen Unterschiede zwischen Codes in der Schweiz und anderen Kulturen.
- Die Kinder stellen fest, dass sich Normen und Codes verändern können – je nach Lebenssituation oder äusseren Umständen (bspw. Corona).
- Die Schüler*innen erkennen, dass wir nicht nur mit Buchstaben und Zahlen kommunizieren.
Die Unterrichtseinheiten
Code knacken
Was Zeichen bedeuten, hängt immer von einem Schlüssel ab. Er bestimmt, wie wir oder der Computer bestimmte Zeichen deuten müssen.
Modul 1: Zeichen, Codes & Etikette
Voll daneben
Unser Alltag ist von Regeln bestimmt. Wir erkennen sie, wenn wir sie brechen.
Modul 1: Zeichen, Codes & Etikette